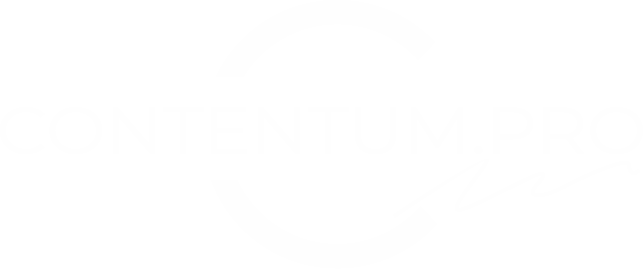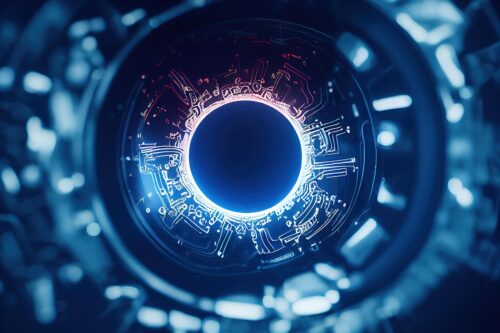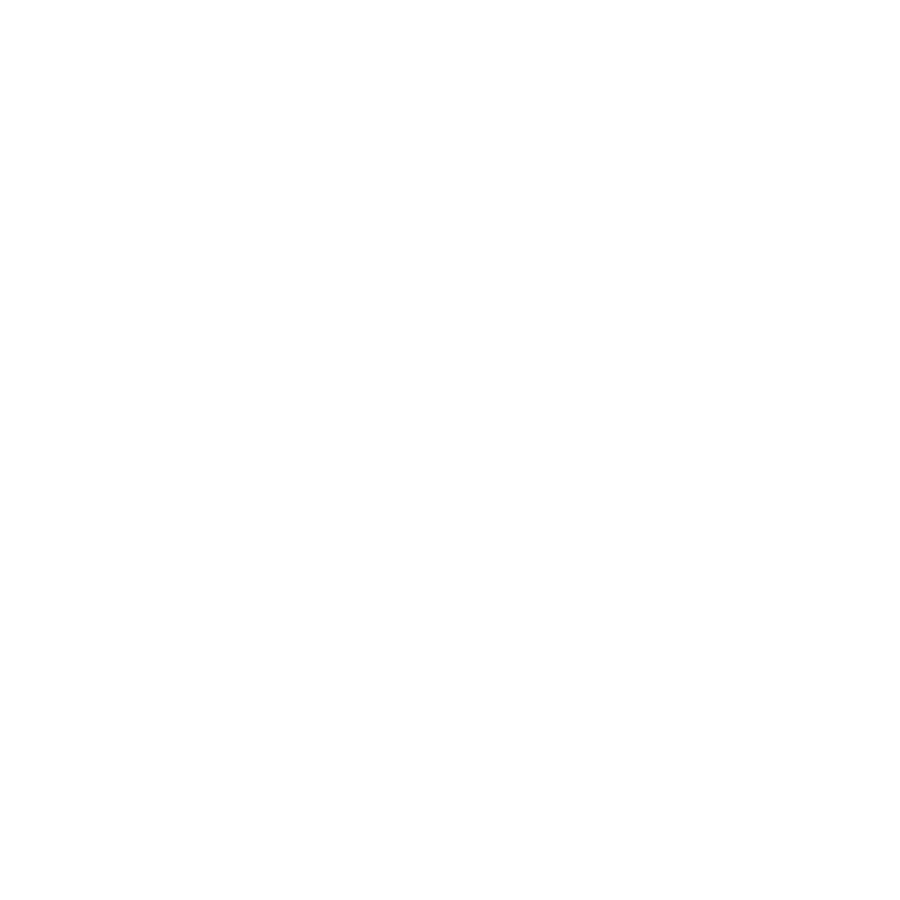Seit dem 28. Juni 2025 gilt in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Damit werden viele Unternehmen erstmals verpflichtet, ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Ziel ist die gleichberechtigte digitale Teilhabe für alle Menschen – insbesondere für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen und Personen mit geringer digitaler Erfahrung. Die Umsetzung sorgt bereits jetzt für Diskussionen. Erste Branchen ziehen eine Zwischenbilanz – zwischen Pflichtgefühl, Unsicherheit und echtem Inklusionswillen.
Digitale Barrierefreiheit: Diese Produkte und Dienstleistungen sind betroffen
Das Gesetz gilt für eine Vielzahl digitaler Anwendungen. Betroffen sind unter anderem:
Computer, Betriebssysteme und Mobiltelefone
Selbstbedienungsterminals wie Geldautomaten und Ticketautomaten
E-Book-Lesegeräte
Telekommunikationsdienste (z. B. Telefonie, Messenger)
Online-Ticketing und Beförderungsdienste
Bankdienstleistungen
E-Commerce-Plattformen wie Webshops oder Buchungssysteme
Websites und digitale Dienste müssen laut BFSG wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust gestaltet sein. Auch Verpackungen, Anleitungen und AGB müssen barrierefrei zugänglich sein. Für viele Anbieter bedeutet das eine grundlegende Umstellung. Erste Rückmeldungen aus der IT-Branche zeigen, dass insbesondere ältere Websites und gewachsene Systeme nicht ohne Weiteres umgestellt werden können. Der Aufwand für technische Nachrüstungen, neue Designsysteme und barrierefreie Dokumentationen wird vielerorts unterschätzt. Während große Anbieter bereits seit Monaten in externe Prüfungen und zertifizierte Testverfahren investieren, stehen viele kleinere Betriebe noch am Anfang – häufig mit der Unsicherheit, ob die eigenen Maßnahmen ausreichen werden. Die Nachfrage nach Beratung zur Barrierefreiheit ist deutlich gestiegen, auch Schulungen für Mitarbeitende nehmen zu.
Wer ist betroffen – und wer nicht?
Grundsätzlich gilt das Gesetz für alle Hersteller, Händler und Anbieter der genannten Produkte und Dienste. Eine Ausnahme gibt es für Kleinstunternehmen, die nur Dienstleistungen anbieten – wenn sie weniger als zehn Mitarbeitende haben und weniger als zwei Millionen Euro Umsatz oder Bilanzsumme. Wer jedoch barrierepflichtige Produkte herstellt, muss die Anforderungen erfüllen – unabhängig von der Unternehmensgröße. Genau diese Unterscheidung sorgt derzeit für Kritik: Zahlreiche Betroffenenverbände sehen die Ausnahme für Dienstleister als zu weitgehend an. Insbesondere in ländlichen Regionen würden viele Dienstleistungen von Kleinbetrieben erbracht, die nun keine Pflicht zur barrierefreien Gestaltung ihrer digitalen Angebote hätten. Die Sorge: Menschen mit Einschränkungen bleiben vom digitalen Alltag vielerorts ausgeschlossen. Gleichzeitig sorgt die Regelung in Unternehmen selbst für Unklarheit. Wann gilt ein Dienst als barrierepflichtig? Wie wird die Bilanzgrenze nachgewiesen? Die Umsetzung wird dadurch zum bürokratischen Spagat – gerade für Betriebe an der Schwelle zur Ausnahmegrenze. Der Gesetzgeber bietet zwar Leitfäden und Anlaufstellen, doch der Informationsstand ist nicht überall gleich.
Was müssen Unternehmen jetzt tun?
Unternehmen müssen eine Konformitätsbewertung durchführen und eine entsprechende EU-Konformitätserklärung abgeben. Produkte erhalten eine CE-Kennzeichnung. Bei Dienstleistungen muss die Barrierefreiheit in den AGB erklärt werden. Wer bestimmte DIN- oder EU-Normen erfüllt, kann sich auf eine sogenannte Konformitätsvermutung berufen. In der Praxis stellt genau das viele Firmen vor neue Herausforderungen. Denn nicht jede Website oder App ist so aufgebaut, dass sie sich problemlos an internationale Standards wie die WCAG 2.1 anpassen lässt. Hinzu kommt: Die Anforderungen an Barrierefreiheit sind nicht rein technischer Natur. Sie betreffen auch Sprache, Gestaltung und Nutzerführung. Die meisten Unternehmen unterschätzen den Aufwand, ein Angebot wirklich verständlich und zugänglich zu machen. Erste Erfahrungsberichte zeigen, dass viele Anbieter den Umsetzungsbedarf zu spät erkannt haben. Besonders betroffen sind Webshops, Banken und Mobilitätsdienste, die eine Vielzahl digitaler Kontaktpunkte anbieten. Hier zeigen interne Audits bereits häufige Mängel in der Tastaturnavigation, kontrastarmen Gestaltung oder fehlender Alternativtexte. Wer keine spezialisierten Agenturen oder Accessibility-Experten einbindet, läuft Gefahr, trotz guter Absicht formale Anforderungen zu verfehlen – und rechtlich angreifbar zu sein.
Konsequenzen bei Verstoß gegen das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
Wer gegen die Vorschriften verstößt, riskiert:
Abmahnungen durch Mitbewerber
Verbraucherbeschwerden bei der Marktaufsicht
Vertriebsverbote oder Rückrufe
Bußgelder bis zu 100.000 Euro
Zuständig für die Marktaufsicht ist eine zentrale Stelle in Magdeburg. Dort können Verstöße gemeldet werden. Noch sind keine prominenten Fälle bekannt geworden. Doch Verbände rechnen damit, dass erste Prüfverfahren bereits laufen. Besonders im E-Commerce und im Finanzbereich werden in den kommenden Monaten stichprobenartige Kontrollen erwartet. Viele Wettbewerber haben bereits angekündigt, auf fehlende Barrierefreiheit mit rechtlichen Mitteln zu reagieren – auch, weil sie selbst bereits investiert haben. Die Abmahnung wird damit zu einem wahrscheinlichen Druckmittel in hart umkämpften Branchen. Unternehmen sind daher gut beraten, jetzt zu handeln, statt das Thema weiter aufzuschieben. Auch Versicherer und Haftungsberater weisen darauf hin, dass Barrierefreiheit künftig Teil des Risikomanagements sein wird – etwa bei Betriebsunterbrechungen durch Rückrufaktionen. Die nächsten Quartale dürften entscheidend sein, ob der Übergang reibungslos gelingt oder zu einem Flickenteppich an Einzelfalllösungen führt.
Erste Reaktionen: Zustimmung und Kritik
Verbände wie der VdK und Aktion Mensch begrüßen das Gesetz als wichtigen Schritt zu mehr Inklusion. Dennoch gibt es auch Kritik: Vor allem die Ausnahme für Kleinstunternehmen und das Fehlen physischer Barrierefreiheit werden als Schwächen gesehen. Noch sind laut Studien nur etwa ein Drittel der meistgenutzten Webseiten barrierefrei gestaltet. Erste Abmahnungen oder Strafen sind bislang nicht bekannt, doch Unternehmen sollten jetzt handeln. Das Gesetz bringt auch gesellschaftspolitische Signalwirkung: Es wertet Barrierefreiheit auf – nicht mehr als freiwillige Leistung, sondern als geschuldete Gleichstellung. Genau deshalb fordert der VdK bereits eine Ausweitung auf weitere Lebensbereiche. Auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) kritisiert, dass viele digitale Produkte zwar barrierefrei beworben werden, aber in der praktischen Anwendung versagen – etwa durch fehlerhafte PDF-Formulare oder komplexe Menüstrukturen. Die Bundesregierung verweist hingegen auf die EU-Richtlinie, die bewusst nur digitale Angebote regelt. Eine nationale Ausweitung sei politisch gewünscht, aber bisher nicht konkret geplant. Für viele Betroffene bleibt also trotz Gesetz ein Gefühl von halber Inklusion.
Fazit: Barrierefreiheit als Standard
Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wird digitale Barrierefreiheit verbindlich. Unternehmen müssen technische, gestalterische und rechtliche Anforderungen erfüllen, um am Markt bestehen zu können. Die nächsten Monate werden zeigen, wie effektiv das Gesetz wirkt – und ob es wirklich gelingt, digitale Teilhabe für alle Menschen sicherzustellen. Fest steht: Der gesetzliche Rahmen ist da, doch die Umsetzung wird nicht ohne Reibung verlaufen. Es braucht klare Standards, verlässliche Kontrollen und langfristige Unterstützung – gerade für kleinere Betriebe. Gleichzeitig eröffnet das Gesetz auch Chancen: Wer frühzeitig in barrierefreie Lösungen investiert, erschließt neue Kundengruppen und stärkt seine Marke. In einer digitalisierten Gesellschaft darf Barrierefreiheit kein Randthema mehr sein, sondern muss zum Qualitätsmerkmal werden.