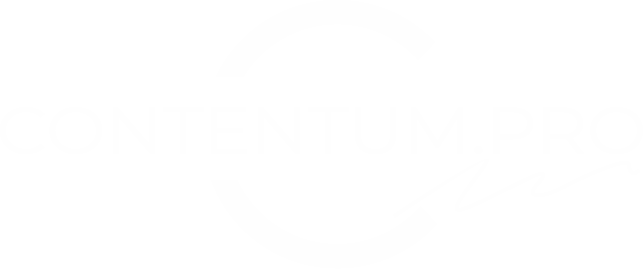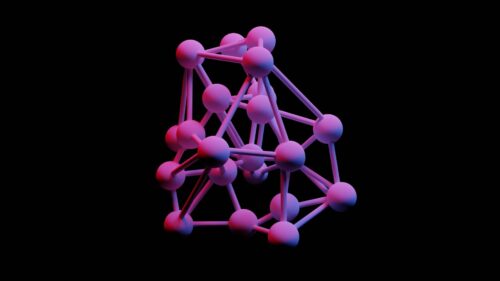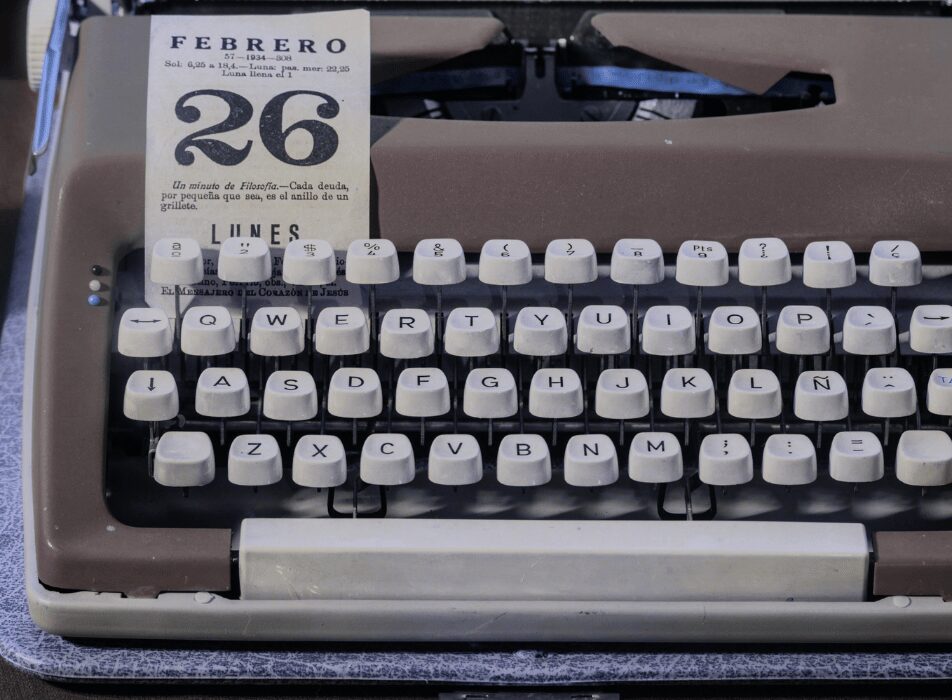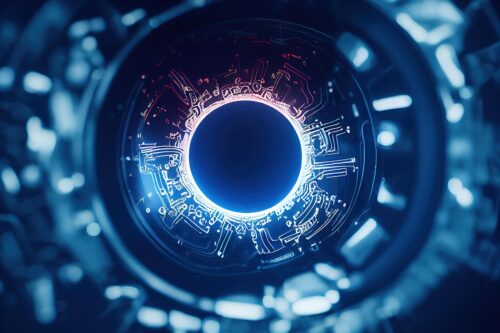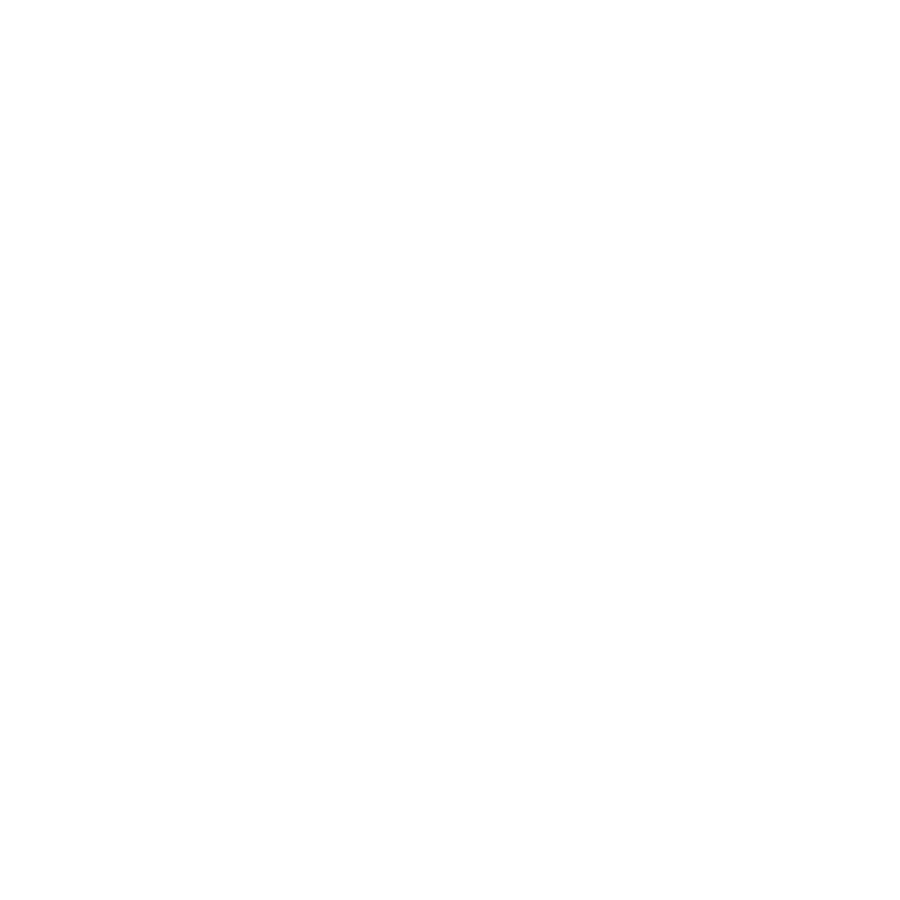Die klassische Google-Suche wird neu gedacht: Mit dem Start des KI-Modus in Deutschland und über 40 weiteren Ländern leitet der Konzern einen der größten Umbrüche seiner Unternehmensgeschichte ein. Statt nur eine Liste mit Links zu liefern, kann Google nun direkt ganze Antworten generieren – auf Basis des hauseigenen KI-Systems Gemini Pro 2.5. Nutzerinnen und Nutzer können künftig nicht nur nach Fakten suchen, sondern in Echtzeit mit den Suchergebnissen „chatten“. Damit reagiert Google auf den rasanten Wandel der Suchgewohnheiten, der durch ChatGPT, Perplexity AI und Microsofts Copilot-Suche stark beschleunigt wurde.
Die neue Funktion wird schrittweise ausgerollt und erscheint in Deutschland zunächst als zusätzlicher Reiter neben „Alles“, „Bilder“, „Videos“ und „Nachrichten“. Wer sie aktiviert, bekommt anstelle langer Linklisten eine strukturierte, erklärende Antwort auf seine Frage – ergänzt um Quellenangaben, die als kleine Fußnoten eingeblendet werden. Google betont, dass der KI-Modus kein Ersatz für die klassische Suche sei, sondern eine „Erweiterung“. Doch die Einführung weckt auch Skepsis, vor allem bei Medienhäusern, die sich fragen, ob Nutzer künftig überhaupt noch auf ihre Websites klicken.
So funktioniert der neue KI-Modus in der Google-Suche
Technisch basiert der KI-Modus auf einer speziell angepassten Variante von Gemini Pro 2.5, einem der leistungsfähigsten Modelle von Google DeepMind. Es verarbeitet komplexe Anfragen in Sekundenschnelle und erstellt daraus eigenständige Antworten, inklusive Begründungen, Übersichten und Handlungsempfehlungen. Ein Beispiel: Statt nur Restaurants aufzulisten, kann die Suchmaschine auf die Frage „Was kann man am Wochenende in Münster mit Freunden unternehmen?“ eine komplette Planung liefern – von Café-Empfehlungen über Veranstaltungen bis hin zu Routenvorschlägen für den Spaziergang am Aasee.
Neu ist auch die Möglichkeit, mehrstufige Dialoge zu führen. Wer eine erste Antwort erhält, kann direkt nachfragen, Details verändern oder weitere Aspekte hinzufügen. Damit verschmilzt die klassische Suche mit einem Chat-Erlebnis. Gleichzeitig blendet Google weiterhin Werbung ein, die jedoch gezielter auf die KI-Antworten abgestimmt wird. Das Unternehmen spricht von einer „neuen Suchgeneration“, die Informationen nicht nur sammelt, sondern interpretiert. Kritiker befürchten jedoch, dass diese Form der Vorauswahl den offenen Zugang zu Wissen einschränkt und die Vielfalt der Quellen gefährdet.
Zwischen Zeitersparnis und Vertrauensfrage
Die Vorteile liegen auf der Hand: Der KI-Modus spart Zeit, reduziert Suchvorgänge und hilft, komplexe Themen schneller zu verstehen. Gerade bei Recherchen zu Reisen, Produkten oder Gesundheitsthemen liefern die neuen Antworten eine bequeme Zusammenfassung. Doch genau hier beginnt das Problem: Die künstliche Intelligenz entscheidet selbst, welche Informationen wichtig sind – und welche nicht.
Mehrere Tech-Magazine verweisen auf eine Studie von Originality.ai, nach der rund zehn Prozent der Quellen in KI-Antworten selbst KI-generiert seien. Das wirft Fragen nach der Verlässlichkeit auf. Google weist die Studie zwar als „fehlerhaft“ zurück, räumt aber ein, dass sich noch nicht alle Algorithmen vollständig überprüfen lassen. Hinzu kommt: Die KI-Antworten erscheinen so überzeugend formuliert, dass Falschinformationen oft nicht als solche erkannt werden. Damit entsteht ein neues Vertrauensproblem, ähnlich wie bei generativen Chatbots.
Die Herausforderung liegt nun darin, Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Google verspricht, die wichtigsten Quellen künftig sichtbarer zu machen. Trotzdem bleibt unklar, ob Nutzer die Originalseiten überhaupt noch besuchen – oder der KI-Antwort blind vertrauen.
Sorge um Reichweite: Medienhäuser schlagen Alarm
Für viele Verlage und Online-Portale ist der KI-Modus ein Risiko. Wenn Google die Antworten selbst liefert, entfallen Millionen Klicks auf die ursprünglichen Websites. In den USA, wo der Modus seit Sommer 2025 aktiv ist, sind die Reichweiten vieler Nachrichtenseiten bereits eingebrochen. Laut Analysen des Unternehmens Similarweb klicken bis zu zehn Prozent weniger Nutzer auf weiterführende Links: ein deutlicher Rückgang. Das bedeutet weniger Sichtbarkeit, geringere Werbeeinnahmen und letztlich weniger finanzielle Mittel für unabhängigen Journalismus.
Medienhäuser in Deutschland fordern daher klare Regeln: Wer Inhalte nutzt, um KI-Antworten zu generieren, soll dafür zahlen oder zumindest den Traffic messbar zurückführen. Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) prüft derzeit, ob Googles Vorgehen gegen Wettbewerbsrecht oder Leistungsschutzrecht verstößt. Die EU-Kommission hat bereits signalisiert, die Auswirkungen auf den Medienmarkt beobachten zu wollen. Google selbst betont, dass hochwertige Quellen weiterhin oft angeklickt würden – insbesondere, wenn sie gut sichtbar verlinkt sind. Doch für viele kleinere Portale dürfte die Abhängigkeit von Google noch größer werden.
Europäische Regulierung und der Weg nach vorn
Mit dem europäischen AI Act, der 2024 in Kraft trat, ist der Einsatz generativer KI erstmals umfassend reguliert. Er schreibt Transparenz, Kennzeichnungspflichten und Qualitätskontrollen vor. Google hat erklärt, sich an die europäischen Standards zu halten und mit der neuen EU-Behörde, dem European AI Office, zusammenzuarbeiten. Dennoch bleibt die Sorge, dass globale Konzerne ihre Marktmacht weiter ausbauen und die Regeln nach eigenen Vorstellungen interpretieren.
Parallel haben mehrere Medienverbände bei der EU eine Kartellbeschwerde gegen Google eingereicht. Sie befürchten, dass der Konzern durch seine KI-Zusammenfassungen journalistische Angebote verdrängt. Auch urheberrechtliche Fragen sind offen: Dürfen KI-Modelle auf redaktionelle Texte zugreifen, um daraus eigene Antworten zu formen? Hierzu liegt inzwischen eine Vorlage beim Europäischen Gerichtshof vor.
Die kommenden Monate werden zeigen, ob der KI-Modus tatsächlich die Informationssuche verbessert oder ob er das Gleichgewicht im digitalen Ökosystem verschiebt. Fest steht: Google verändert die Spielregeln des Internets erneut. Und diesmal betrifft es nicht nur die Art, wie wir suchen, sondern auch, wem wir am Ende glauben.