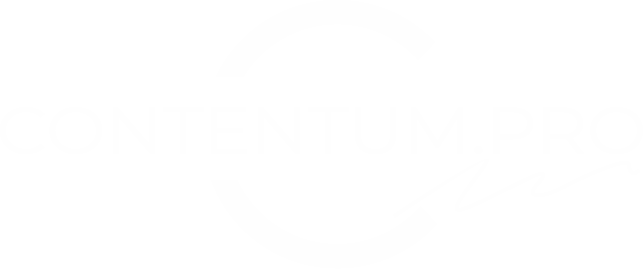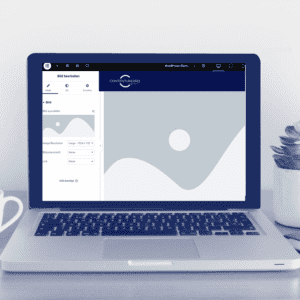Videos & SEO: Infos und Einstellungen mit Elementor
Das Elementor Video Widget ermöglicht Benutzern, Videos in verschiedenen Formaten und von verschiedenen Quellen einzubetten und anzupassen, um eine beeindruckende visuelle Darstellung zu erzielen. So